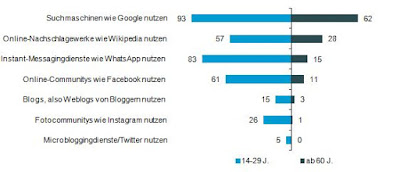 |
| ARD/ZDF-Onlinestudie Blog-Nutzung in Deutschland 2015 |
Im Dezember 2015 war es dann soweit und ich habe das erste Mal einem Blog eines Landesministeriums ein Interview gegeben. Dem Blog des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus habe ich einiges zum Thema politische Onlinekommunikation, Medienkompetenz und Hass im Netz erzählt.
Anlass für mich, mir einmal die Ministeriums-Blogs der 142 deutschen Landesministerien und Staatskanzleien genauer anzusehen. Eine Bestandsaufnahme.
Blog der Landesregierung NRW
 |
| Blog der Landesregierung NRW |
Seit Februar 2015 bloggt die Landesregierung NRW unter
land.nrw/de/aktuelles-und-presse/nrw-blog.
Damit war die Staatskanzlei am Rhein die erste in Deutschland, die einen Ministeriums- übergreifenden Blog ins Leben rief.
Leider hat es nicht für eine besonders schöne (und leicht merkbare) Domain gereicht und die Startseite sieht auch eher nutzerunfreundlich und zum Wegrennen aus.
Aber die Inhalte überzeugen. Blogger sind ausschliesslich Kabinettmitglieder, Staatssekretäre und einige wenige Gastautoren aus anderen Behörden des Landes. Die Beiträge sind kurz, gut geschrieben und befassen sich mit neuen Projekten und Ideen der Landesregierung. Neben dem gewissen Sexappeal, dass Ministerinnen und Minister selber bloggen, sind die Beiträge jeweils mit einem großen Bild angeteasert. Die Postings können kommentiert werden, hierfür ist allerdings eine Registerierung notwendig. Von daher wird diese Funktion leider bisher so gut wie nicht genutzt.
Bienenblog des Niedersächsischen Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
 |
| Bienenblog des Niedersächischen Landwirtschaftsministeriums |
Seit Ende Juli 2015 gibt es den "Single-Issue"-Blog zum Thema Bienen des Niedersächsischen Landwirtschaftsministeriums des grünen Ministers Christian Meyer.
Ziel des Blogs ist es, eine "Menge Wissenswertes aus der geheimnisvollen und wunderbaren Welt der Bienen zu vermitteln".
So wirklich bloggig ist der Blog aber bisher nicht. Neben den Pressemitteilungen zum Thema gibt es bisher lediglich ein Interview mit dem Minister, eine Bildergalerie und zwei weitere Artikel, die in sehr formeller Sprache über das Thema referieren. Zudem schade, dass das Blog als Unter-Unter-Thema auf den Seiten des Ministeriums etwas versteckt ist. So werden ihn wohl nur wenige Bienenfreunde finden. Zumal die Domain auch eher an ein IT-Projekt aus den 90ern errinnert.
Notiz-Blog des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie Schleswig-Holstein
 |
| Notiz-Blog des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie |
bloggt die Pressestelle des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie des Landes Schleswig-Holstein.
Zielgruppe des Blogs sind klar Journalisten zwischen Förde und Bokelholmer Fischteiche. Im Grunde genommen ist der Blog damit soetwas wie die moderne Form der klassischen Pressemitteilungs-Webseite. Im Mittelpunkt steht meistens der Minister. Die Texte sind im Stil von Pressemitteilungen verfasst, dazu gibts Bilder, Videos und - sehr genial - Audiofiles, meist mit Aussagen des Ministers. Ein sehr guter Service für die Kollegen vom Radio und für den ein oder anderen Bürger, der sich zwar ungern lange Texte durchliest aber um so lieber Minister Reinhard Meyer (SPD) zuhört.
Externe Blickwinkel findet man hier leider nicht. Ebenso vermisse ich den persönlichen Blick des Minsters bzw. den Blick hinter die Kulissen des Ministeriums - neben den formellen und offiziellen Aussagen.
SMK-Blog des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus
 |
| SMK-Blog des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus |
Das Blog hat ein eigenes Logo, arbeitet mit inhaltlichen Metatags und Kategorien zur besseren Durchsuchbarkeit, ist problemlos und niedrigschwellig kommentierbar, listet die letzten Beiträge und Kommentare auf und hat den Twitter-Feed des Ministeriums eingebunden.
Also alles was ein gutes Blog braucht.
Zudem versucht man - wie an meinem Beispiel zu sehen - Externe und deren Sichtweisen und Meinungen einzubinden und macht damit das Blog und somit die Inhalte des Ministeriums insgesamt spannender für die Leser.
Der inhaltliche Fokus liegt auf den Themenbereichen des Ministeriums, neben PR-Texten werden auch kritische Themen aufgegriffen z.B. in Form von Faktenschecks zum Thema Flüchtlinge. Redaktionell finde ich dies gelungen, nur graphisch könnte der Blog noch ein wenig mehr Lesekomfort bieten.
Und sonst?
Zudem habe ich noch folgendes Blog in der rheinland-pfälzischen Landesverwaltung gefunden:Blog des Landesbeauftragten für die Belange behinderter Menschen Rheinland-Pfalz.
Tagebuch Bodo Ramelow (Die LINKE.)
 |
| Online-Tagebuch Bodo Ramelow (Die LINKE.) |
Das Blog besteht bereits seit 2008, alte Teile des Tagebuchs wurden archiviert, sind aber weiterhin abrufbar. Ab 2011 erscheinen die Texte nicht mehr unter bodo-ramelow.de/tagebuch/, sondern unter Aktuelles. Das ist ziemlich verwirrend. Zudem sind alte Texte nur über die Suchfunktion der Seite und das relativ versteckte Archiv auffindbar. Die Ergonomie des Blogs ist stark verbesserungswürdig.
Selbstverständlich gibt es inhaltliche Kategorien, eine Schlagwortwolke, eine RSS-Funktion und die Beiträge sind einfach kommentierbar.
Inhaltlich finde ich das Blog ebenfalls sehr gelungen. Hier hat der Ministerpräsident den Platz und das Format, seine eigene Sicht zu präsentieren, abseits der Regierungsseiten und seiner erfolgreichen Accounts bei Facebook und Twitter. Und das macht er aus meiner Sicht sehr gut. Als Leser kommt man gefühlt sehr nah an die Person Ramelow heran. Man merkt dem Blog an, dass es mit Passion betrieben wird und nicht lediglich die fixe Idee einer hippen Online-Agentur war.
Und die anderen Minister(-präsidenten) ?
Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat so etwas Ähnliches wie ein Blog. Auf seiner Webseite stephanweil.de veröffentlicht er eine wöchentliche "Kolumne". Ich würde sagen auch so eine Art persönliches Blog aus dem Leben eines Ministerpräsidenten.
Thüringens Kultus-, Bundes- und Staatsminister Prof. Benjamin-Immanuel Hoff bloggt seit Ende 2013 auf freitag.de zu allen Themen "die ihn interessieren", darunter seit seiner Berufung auch von seiner Arbeit als Leiter der Staatskanzlei Thüringen.
Fazit
 |
| BITKOM-Studie "Demokratie 3.0" |
Im Rahmen der Bundestagswahl 2013 habe ich dem Portal Wahlkampfanalyse.de ein Interview zum Thema Bloggerrelations in der Politik gegeben, in dem ich erkläre warum es für Politiker und Parteien richtig und wichtig ist aktiv auf Blogger zuzugehen. Das scheint das Sächsische Kultusministerium ja schon mal erkannt zu haben ;)
Janine Bilker hat bei den Netzpiloten zudem richtigerweise festgestellt, dass man zum bloggen heute gar kein eigenes klassisches Blog mehr benötigt - es gibt unzählige gute Alternativen.
Habe ich einen Blog eines Ministeriums übersehen? Über Hinweise zu weiteren neuen Blogs aus der Exekutive würde ich mich sehr freuen.
Hinweis: In vorherigen Postings habe ich bereits die Facebook- und die Twitter-Aktivitäten der Landesministerien analysiert.
Mit DRadio Wissen ("Schaum oder Haase") habe ich zu dieser kleine Analyse im Radio gesprochen und noch ein paar weitere Bewertungen zu den bloggenden Ministerien abgegeben.































