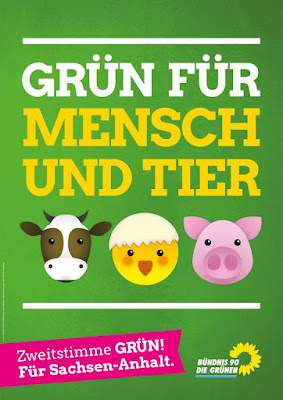Dies ist ein Gastbeitrag von Bastian Rosenzweig, er hat im letzten Semester sein Bachelorstudium in
Kommunikationswissenschaft, Philosophie und Soziologie an der
Otto-Friedrich-Universität Bamberg abgeschlossen. Im Blog
präsentiert er zentrale Ergebnisse seiner Bachelorarbeit zum Thema Hate Speech auf den
Facebook-Seiten deutscher Bundesparteien. Hierzu analysierte er die zwischen 2016 - 2018 auf den Facebook-Seiten von CDU, CSU, SPD, LINKE,
Grünen, FDP und AfD veröffentlichten Kommentare.
 |
| Logo Otto-Fiedrich-Universität Bamberg |
Hate Speech
Der Fall Lübcke zeigt in aller Deutlichkeit, was schon länger klar ist: dass sich Hate Speech im Internet nicht von der „realen“ Welt trennen lässt. Hassbeiträge wirken auf individueller Ebene ähnlich wie Mobbing, auf gesellschaftlicher Ebene können sie den Diskurs verzerren und die strukturelle Benachteiligung bestimmter Gruppen reproduzieren. In einer Studie der Landesanstalt für Medien NRW gibt über ein Drittel der Befragten an, von Hasskommentaren verängstigt zu sein. Eine Umfrage von Campact ergab, dass sich circa die Hälfte der Befragten wegen Hate Speech seltener zu ihrer politischen Meinung bekennen.
Unter Hate Speech fallen in den gängigen Definitionen alle Äußerungen, die die Herabsetzung (also nicht etwa die Kritik) bestimmter, meist marginalisierter, Gruppen zum Ziel haben. Darunter fallen beleidigende Beiträge, die auf ganze Gruppen abzielen, aber auch herabwürdigende Äußerungen gegenüber Einzelpersonen, sofern die Herabwürdigung mit der (vermeintlichen) Gruppenzugehörigkeit begründet wird.
 |
| Abb 1. Facebook-Abonnierende nach Partei |
Das
Ausmaß
In den
drei Jahren wurden insgesamt 4.447.947 Kommentare auf den
Facebook-Seiten der sieben Parteien veröffentlicht, aus denen dann
eine einfache Stichprobe gezogen wurde. Hate Speech findet sich in
4,33% der Beiträge. Bei der AfD (auf die 32% aller Abonnierenden und
über ein Drittel aller Kommentare abfallen) ist dieser Anteil mit
6,79% am höchsten. Darauf folgen die Grünen mit 4,76% und die
Linken mit 3,38%. Da Kommentare bei Facebook von den
Seitenbetreiber*innen gelöscht werden können, muss man davon
ausgehen, dass der Anteil eigentlich größer ist.
 |
| Abbildung 2: Anteil an Hasskommentaren nach Partei und Jahr |
Welche Themen ziehen Hasskommentare nach sich?
Wo
Hasskommentare veröffentlicht werden sagt nur bedingt etwas über
deren Inhalt aus, da ja auch Rechtsradikale bei den Linken
kommentieren können oder Linke bei der AfD. Aufschlussreicher ist da
ein Blick auf den Inhalt bzw. die Gruppe, die das Ziel der
Hassbeiträge ist. Hate Speech findet sich unter Posts zu fast allen
Themen. Der größte Anteil fällt hierbei ab auf die Themen
Frauenrechte (15,38%), Terrorismus (11,32%) und Rechtsextremismus
(10,91%).
 |
| Abbildung 3: Themen, die Hasskommentare nach sich ziehen |
Wer ist betroffen?
Opfer von Hate Speech sind in 46,67% der Fälle Migrant*innen, im Jahr 2017 lag der Anteil sogar bei 69,23%. Der am häufigsten gelikete Hasskommentar fällt ebenfalls in diese Kategorie und beinhaltet die Aussage: „Hälse durchschneiden , das ist was sie kennen und wollen …“ Er wurde 2018 auf der Facebook-Seite der AfD veröffentlicht und bis zur Erhebung im März 2019 nicht entfernt. Des Weiteren richten sich die Hassbeiträge gegen Politiker*innen im Allgemeinen (14,44%), Muslim*innen (12,22%) und Linke (10%). Auffällig ist, dass Hasskommentare bei den Linken in 60% der Fälle auf Linke abzielen. Auch hier scheinen also eher rechts gesinnte Personen zu kommentieren.
 |
| Abbildung 4: Betroffene nach Jahr |
Die vor allem von Anhänger*innen der AfD immer wieder bemühte These, Rechte bzw. Konservative seien ebenso oft Opfer von Hate Speech wie alle anderen konnte nicht bestätigt werden. Nur 1,11% aller Hasskommentare richten sich gegen rechte/konservative Personen. Viel mehr lässt ein Großteil der Hasskommentare auf eine rechtsextreme Gesinnung des*der Verfasser*in schließen. Wenn man sich die Definition von Hate Speech ansieht, ist auch nichts anderes zu erwarten: Die Herabsetzung benachteiligter gesellschaftlicher Gruppen wird i. d. R. von rechtspopulistischen bis konservativen Kräften vorangetrieben.
Hate Speech in der Echokammer
Ein weiteres Ergebnis, das aus der Arbeit hervorgeht ist, dass Kommentare, die Hate Speech enthalten öfter mit „Gefällt mir“ markiert werden als Kommentare ohne. Neutrale Beiträge erhalten im Schnitt 2,60 Likes, bei Hasskommentaren liegt diese Zahl bei 4,73. Auch hier gibt es zwischen den Parteien große Unterschiede: Bei der SPD, CDU, FDP und Linken werden Hasskommentare seltener geliket als neutrale Beiträge. Einzig bei den Grünen (2,17 zu 1,81), der CSU (2,3 zu 1,87) und der AfD (5,97 zu 2,89) werden Hasskommentare häufiger mit „Gefällt mir“ markiert, bei der AfD sogar mehr als doppelt so häufig. Da die Hate Speech-Beiträge hauptsächlich auf rechtsradikale bis rechtsextreme Gesinnungen schließen lassen, kann man aufgrund dieser Zahlen davon ausgehen, dass die Seite der AfD eine Art Echokammer für solcherlei Ansichten bildet.
Auch wird auf Posts (der Parteien selbst), die bereits Hate Speech enthalten häufiger mit Hasskommentaren reagiert wird als auf andere. Auf „neutrale“ Posts folgt in 4,23% der Fälle Hate Speech, bei Hassposts ist dieser Anteil mit 8,47% ungefähr doppelt so hoch. Da die AfD die einzige Partei ist, die regelmäßig selbst Hate Speech-Beiträge veröffentlicht, kann man vermuten, dass sie selbst zum Anteil der Hasskommentare beiträgt.
Rechtsextremer Hass
Insgesamt ist erkennbar, dass Hate Speech erstens häufig (in mindestens 4,33% der Fälle) anzutreffen und zweitens eine vor allem rechtsextreme Angelegenheit ist.
4.33% scheinen kein so großer Anteil zu sein. Allerdings muss man beachten, dass hierunter wirklich nur Hate Speech fällt und keine reinen Falschinformationen, Beleidigungen oder harmlosere hämische Kommentare. Ebenfalls ist zu berücksichtigen, dass sechs der sieben Parteien angeben, solche Beiträge zu löschen. Zudem enthalten über 35% der Posts auf die sich die Kommentare beziehen nur harmlose parteibezogene Inhalte wie Mitgliederwerbung, anstehende Termine oder Feiertagswünsche.
 |
| Abbildung 5: Politische Einordnung der Hasskommentare |
Dass das Phänomen Hate Speech tendenziell rechtsextremer Natur ist, ist einerseits an den betroffenen Themen und Gruppen erkennbar, andererseits auch am Facebook-Auftritt der AfD selbst. So ist sie die einzige Partei, die keine Kommentarregeln auf ihrer Seite eingebunden hat und auch keine solchen anzuwenden scheint, da sie eine hohe Zahl von Hasskommentaren stehen lässt, selbst wenn darin gefordert wird, anderen Menschen die Hälse durchzuschneiden.
Die komplette Bachelorarbeit von Bastian Rosenzweig gibt es bei Das NETTZ zum Download
Autor
 |
| Bastian Rosenzweig |
Twitter: @bastianrosen2g